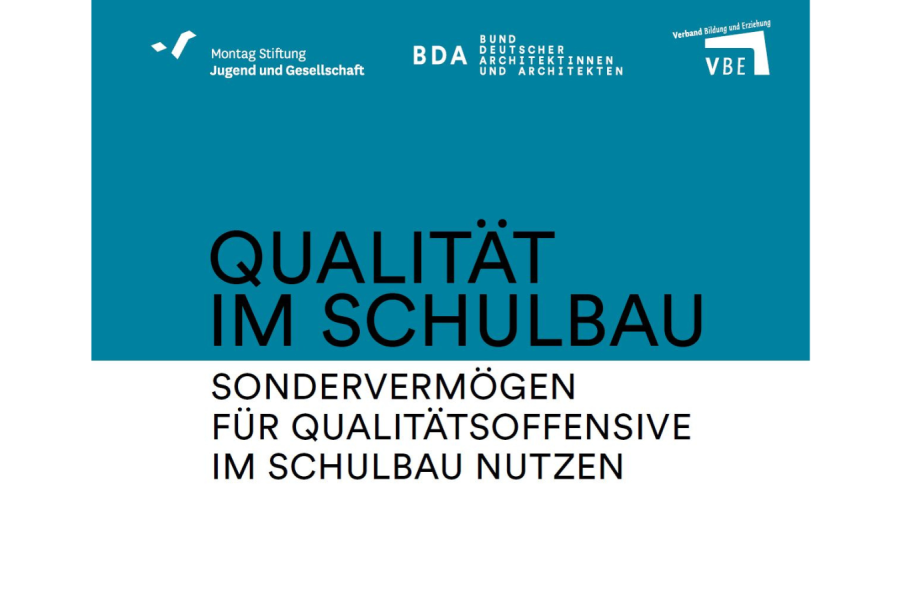Was mit der ersten Konferenz im Oktober in Berlin begann, fand in Essen seine Fortsetzung – und seine Vertiefung. Die zweite Schulbaukonferenz in Essen fand an einem Ort statt, der selbst für Wandel steht: der Zeche Carl. Hier, wo aus industriellem Erbe kultureller Freiraum wurde, diskutierten Vertreter*innen aus Pädagogik, Architektur, Verwaltung und Verbänden sowie Schüler*innen über Anforderungen und Lösungen im Schulbau heute. Ein Thema: wie Schulen zu Orten werden können, an denen Kinder und Jugendliche sich wohlfühlen – und damit besser lernen.
Das die Veranstaltung ausrichtende Kooperationsbündnis von Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft, Bund Deutscher Architektinnen und Architekten und dem Verband Bildung und Erziehung betonte erneut: Mit dem Infrastruktursondervermögen muss der Bau, die Sanierung und Modernisierung von Schulgebäuden gefördert werden. Dabei geht es nicht nur um Quantität, sondern besonders um Qualität.
Wie zentral dabei das Wohlfühlen ist, zeigten die Schüler*innen auf dem Podium. Schüler der Jenaplanschule Weimar berichteten, wie sie im Planungsprozess beteiligt waren, in ihrer Schule sogar Möbel selbst gebaut und damit Verantwortung für ihre Lernumgebung übernommen haben – und dass diese Möbel nun besonders gut behandelt werden. Schülerinnen aus dem Bürgerrat Bildung und Lernen berichteten, was ihren Schulen fehlt, um echte Wohlfühlorte zu sein. Quentin Gärtner, Bundesschülersprecher, erinnerte sich an eine Begegnung mit einer Lehrkraft, die ihn in der Schule zurechtwies, sich hier nicht zu entspannen, sondern zu lernen. In der Konferenz wurde deutlich: Beides zusammen muss möglich sein – und ist es auch schon.
Silvia-Iris Beutel, Professorin für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik an der TU Berlin, schlug den Bogen weiter. „Wir leben nicht mehr in Zeiten sicherer Wahrheiten, sondern sicherer Unsicherheiten“, sagte sie. Pädagogik im Zusammenspiel mit Architektur muss darauf reagieren. Anhand von Beispielen zeigte sie, wie offenere Lernraumstrukturen zukunftsgerichtete Pädagogik unterstützen und gleichermaßen Beziehung und Selbstlernen fördern. Schulen werden Teil des Quartiers, reagieren flexibel auf Veränderungen und geben Kindern Räume, die sich anpassen, statt zu begrenzen. In Essen wurde deutlich: Innovation im Schulbau heißt nicht futuristische Technik, sondern sinnvolle Gestaltung, die Lernprozesse unterstützt.
Wie diese Qualität anhand von Kriterien bewertet wird, erläuterte Vera-Lisa Schneider, Referatsleiterin Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, Pädagogische Architektur, Innerer Dienst Schulministerium NRW: Die Vergabe des vom Ministerium in Kooperation mit der Architektenkammer NRW vergebene Schulbaupreis basiert auf einem Kriterienkatalog für qualitätsvollen Schulbau, der Pädagogik und Architektur verbindet und fragt, wie Architektur pädagogische Qualität unterstützt. Bei Begehungen vor Ort wird bewertet, wie Schulbau wirksam auf die pädagogische Arbeit einzahlt – Wohlfühlorte gehören dazu.
Schulleitungen aus Pilotprojekten der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft zeigten schließlich, wie Innovation im Alltag aussehen kann, wenn auch die Nutzer*innen inklusive der Kinder zum Nutzungskonzept für die vorhandenen Räume beitragen. Ergebnis: Es lohnt sich, das Zutrauen zu haben. Die Pilotprojekte „Ganztag und Raum“ der Stiftung zeigen, dass es auch im Bestand viele Optionen gibt, um Räume und Flächen zusammen mit der Pädagogik neu zu gestalten. Nach Aktivitäten geplante Nutzungskonzepte sind offener, variabler und bieten Räume, „in denen Dinge möglich werden, die niemand zuvor hätte planen können“.
Gleichzeitig wurde klar, wie groß die Spannungen im System sind. Während an einigen Orten durch integrierte Planung kreative Lernumgebungen entstehen, zielen an anderen Orten Kommunen auf schnelle Lösungen mit Generalübernehmern, deren ökonomisches Interesse auf Standardisierung liegt. Aus dem Plenum kam der Hinweis, dass sich dies oft wie zwei parallele Realitäten anfühle – auf der einen Seite die standortspezifische Planung von hochwertigen Lernlandschaften, auf der anderen Seite serielle Zweckbauten, die nicht auf Nachhaltigkeit abzielen. Genau an dieser Stelle müsse das Sondervermögen ansetzen: mehr Freiheit für innovative Lösungen statt starrer Vorgaben. Denn im ökonomischen Interesse der Kommunen liegt es, nachhaltige Bildungsstandorte zu schaffen – und nicht schnelle Lösungen, die die Anforderungen eines Standorts nicht erfüllen und so sogar hohe Folgekosten verursachen können.
Wie es anders gehen kann, zeigte Nicola Küppers, Schulleiterin der Grundschule am Dichterviertel in Mülheim a.d.R., deren „Abenteuerwelten“ ganztägig vom Team aus Lehrkräften und Erziehungspersonal genutzt werden. „Menschen brauchen angstfreie Räume, um sich zu entwickeln“, sagte sie – und plädierte für mehr Mut in den Verwaltungen: „Man muss auch mal heiter scheitern dürfen.“ Auch der Satz des Tages kam von ihr und verdeutlicht, wie zentral Wohlfühlen ist: „Schule muss nicht der beste Ort sein, aber der schönste.“
Ein weiterer zentraler Punkt: Instandhaltung. Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur betonte, dass Schulbau nicht beim Einweihungsfoto endet. Ohne dauerhaft gesicherte Pflege verfällt Qualität zwangsläufig. Seine Forderung nach einer „Phase Zehn“ und einer verbindlichen Regelung zur kontinuierlichen Unterhaltung und Weiterentwicklung von Gebäuden, wurde sehr positiv aufgenommen. Denn: Gute Räume müssen gepflegt werden, wenn sie langfristig wirken sollen.
Die Essener Schulbaukonferenz machte deutlich: Wohlfühlen ist nicht weich, nicht dekorativ, nicht zweitrangig. Es ist ein zentrales Qualitätskriterium für guten Schulbau – zusammen mit der Bereitschaft, Innovation zuzulassen, Pädagogik und Architektur zusammenzudenken und Gebäude langfristig als lebendiges Ganzes instand zu halten und zu pflegen. Das Sondervermögen schafft nun die Chance, diese Prinzipien fest zu verankern. Wenn es gelingt, daraus eine gemeinsame Linie zu machen, kann aus Sanierung echte Zukunft werden.